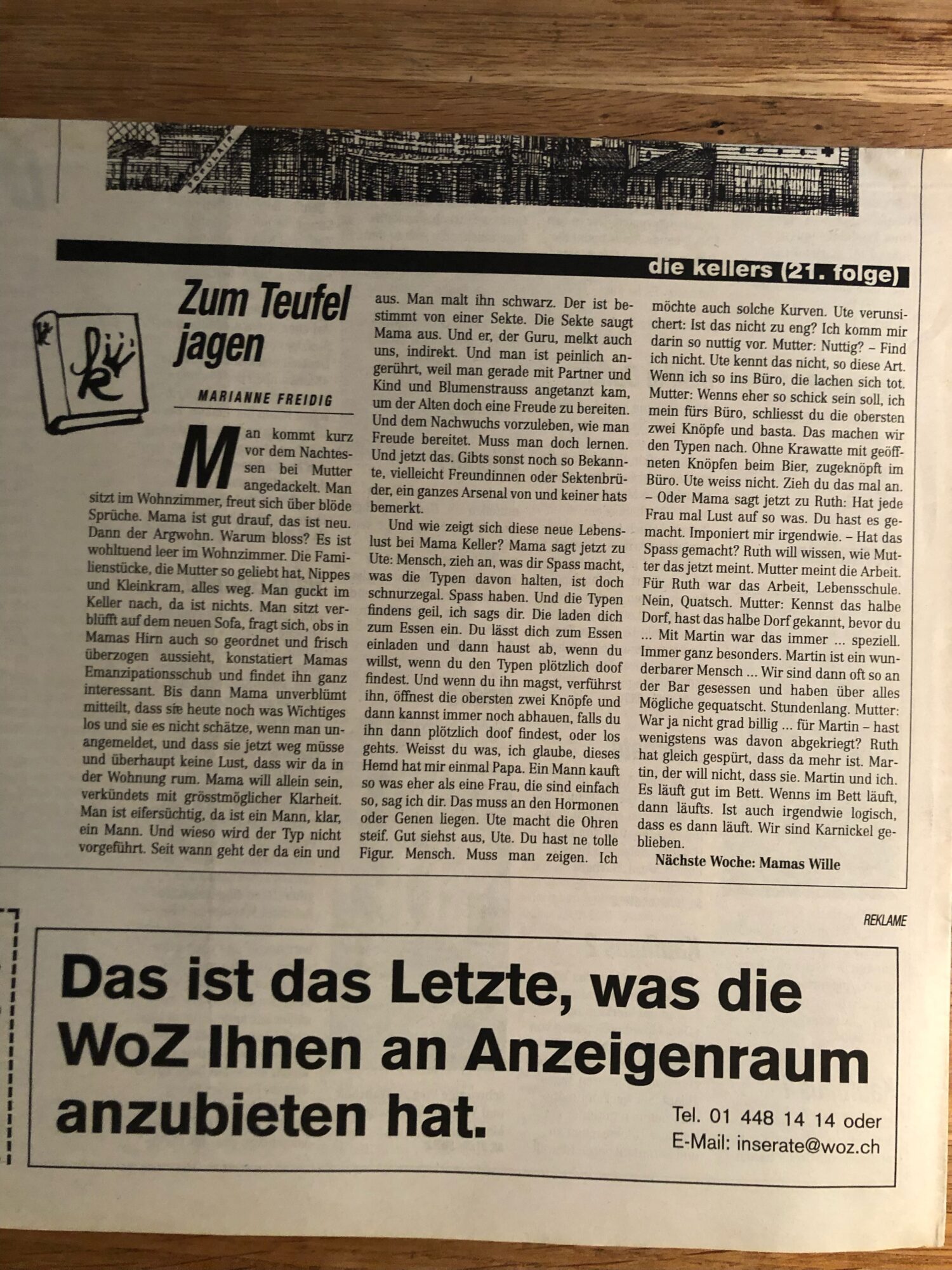Du warst Teil der ersten Generation des Dramenprozessors. Wie sehr hat diese Anfangsenergie euch Teilnehmer*innen und euer Schreiben beflügelt?
Es war ein neues Projekt. Energie war da, richtig viel. Es war wohl für fast alle das Sprungbrett. Kaum war man da, öffneten sich einem die Tore zur Welt des Theaters einen Spalt weit. Ich kam aus der Kunst- und Literaturszene, hatte vorher einen ziemlich absurden Einakter geschrieben über einen Galeristen, der den Künstler*innen Bilder hinterher wirft. Das war, was ich dramatisch zu bieten hatte. Ja, und dann ging es schnell. Kaum hatten die ersten Treffen der Autor*innen mit der damaligen Leitungscrew des Dramenprozessors Peter Kelting und Eric Altdorfer stattgefunden, wurden quasi im Geiste der Autorenwerkstätten des englischen Royal Court Theaters, Proben mit Schauspieler*innen und Regisseur*innen angesetzt. Geprobt wurde mit einzelnen Szenen, die oft erst angeschrieben oder in einer rohen Version vorlagen, das gab mir als Autorin die Möglichkeit auszuloten, was wie wirkte, usw. Das war fantastisch und für mich das beste am Dramenprozessor. Es war im Grunde genommen ein simulierter Theateralltag. Ich erlebte das Theater von innen, war ein Teil von ihm, fühlte mich auch in dieser Szene rasch zuhause, zuerst in der Schweiz, dann in Deutschland. Da war viel Energie da. Ich erinnere mich an eine hitzige Diskussionen im Kreise meiner Kolleg*innen während einem Workshop. Mein Beitrag waren zwei, drei Seiten einer Videotranskription. Das Video hatte der Schauspieler Sigi Terpoorten, der bei diesen Vorproben oder Try Outs oft dabei war, aufgenommen und mir irgendwann gezeigt. Ich war von diesem fulminanten familiären Endspiel, das sich in einem Wohnzimmer oder einer Küche abspielte, so genau weiss ich das nicht mehr, in dem den Mitspielenden in Sekunden alle Teppiche unter den Füssen weggezogen wurden, überrascht und entsetzt, gleichzeitig erheiterte mich die ungeheure Komik. Da war viel Alltagsenergie drin. Dieser kurze, auf Video gebannte Moment war das zündende Moment für das Stück Manana, eine Familienreparatur in vier Tagen.
Mich interessierte beim Schreiben der Klang, die Musik, ich experimentierte mit Tempowechseln etc. Peter Kelting stellte wichtige Fragen, beriet bei der Suche nach der Form. Ein paar Monate später war das Stück geschrieben. Mein Vertrauen in die Regisseurin Anina La Roche war gross. Ich wusste: Die letzte Entscheidung zum Text würde bei mir als Autorin liegen. Wir waren uns grossmehrheitlich einig, meine ich mich zu erinnern. Ich bemerkte bei den Proben, dass es für Schauspieler*innen schwierig war, meine Witzszenen x-mal zu proben und würzig frisch zu spielen, als hörten sie die Witze zum ersten Mal.
Das Stück wurde wild und gut, finde ich auch heute noch. Als Manana als Dramenprozessorproduktion ausgewählt und in der Inszenierung von Anina La Roche gespielt wurde, verirrte sich irgendwann einmal - das Stück war an der Winkelwiese verlängert worden - ein Herr namens Stefan Schmidtke, der für die Wiener Festwochen auf der Suche nach neuem Stoff um die Welt reiste, in das Zürcher Theater-Kellergewölbe. Kurz darauf war das Stück am Schauspiel Stuttgart zu sehen. Dann kamen Angebote von Verlagen und alles nahm seinen Lauf.
Wir Absolvent*innen profitierten davon, dass der Dramenprozessor in den Theaterkreisen rasch eine gewisse Neugierde hervorgerufen hatte. Bald genossen wir einen guten Ruf, die Schweizer Dramatiker*innen seien interessant, hiess es. Am Schauspiel Stuttgart wurde ich auf einem Podium gefragt, was denn die Schweizer*innen beim Schreiben anders machten als die Deutschen? Ich wusste es nicht.